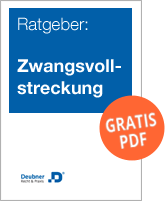Die Pfändung ist eine Form der Zwangsvollstreckung. Ist ein Schuldner nicht in der Lage seine Schulden zu begleichen, so haben die Gläubiger die Möglichkeit, eine Pfändung der Vermögenswerte des Schuldners zu beantragen. Dies können zum Beispiel Konten, Gehälter, Gegenstände, oder Forderungen des Schuldners sein.
Rechtsgrundlagen der Pfändung
Die Rechtsgrundlagen für die Pfändung sind in der deutschen Zivilprozessordnung (ZPO) geregelt. Das Verfahren beginnt mit einem Vollstreckungsbescheid oder einem Urteil, das vom Gericht ausgestellt wird. Der Gläubiger kann dann einen Antrag auf Pfändung beim zuständigen Vollstreckungsgericht stellen.
Welche Konsequenzen hat eine Pfändung?
Wenn der Schuldner auf einen Mahnbescheid keinen Widerspruch erhebt, kann der Gläubiger einen Vollstreckungsbescheid (§ 692 Abs. 1 ZPO) beantragen. Mit diesem Bescheid kann der Gläubiger die Zwangsvollstreckung betreiben.
Der Pfändung unterliegen diejenigen beweglichen Sachen des Schuldners, die sich in seinem Eigentum befinden.
Wenn eine Pfändung erfolgreich ist, hat dies zwei Folgen:
- Verstrickung: Der betroffene Vermögensgegenstand wird in das Vermögen des Gläubigers eingebunden und kann nicht mehr frei übertragen oder belastet werden.
- Pfändungspfandrecht: Der Gläubiger erwirbt ein Pfandrecht an dem betroffenen Vermögensgegenstand.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass eine Pfändung in Deutschland gesetzlich verboten ist, wenn der zu pfändende Gegenstand als "unpfändbar" gilt.
Welche Vermögenswerte sind unpfändbar?
Das bedeutet, dass bestimmte Vermögenswerte wie beispielsweise Kleidung, Hausrat, Werkzeuge und Gegenstände des täglichen Gebrauchs nicht gepfändet werden können. Liegt keine Unpfändbarkeit vor, kann der Gläubiger aufgrund eines Vollstreckungstitels die Pfändung des Vermögens des Schuldners veranlassen.
Dabei wird das Vermögen des Schuldners in Besitz genommen und zur Befriedigung der Forderung des Gläubigers verwertet. Die Verwertung erfolgt durch die Versteigerung der Gegenstände oder durch die Überweisung des gepfändeten Geldbetrags auf das Konto des Gläubigers. Die Pfändung hat für den Schuldner oft schwerwiegende Konsequenzen, da er durch den Verlust seines Vermögens in seiner wirtschaftlichen Existenz bedroht sein kann.
Arten der Pfändung
Es gibt verschiedene Arten von Pfändungen:
- Sachpfändungen: Bewegliche Sachen werden durch den Gerichtsvollzieher in Besitz genommen. Dazu gehören Geld, Wertsachen und Wertpapiere. Weniger mobile Sachen bleiben beim Schuldner und erhalten ein Pfandsiegel
- Forderungen und Rechte: Forderungen und andere Vermögensrechte, auch zum Beispiel Web-Domains. Auch die Kontopfändung, Gehaltspfändung und Lohnpfändung fallen in diesen Bereich
Es gibt auch bestimmte Schutzmaßnahmen für den Schuldner, wie z.B. die Freigrenzen für Einkommen und Vermögen, die vor der Pfändung geschützt sind. Der Schuldner kann auch Widerspruch gegen die Pfändung einlegen, wenn er glaubt, dass sie nicht gerechtfertigt ist.
In den folgenden Abschitten haben wir für Sie relevante Gerichtsentscheidungen zur Pfändung zusammengestellt. Lesen Sie jetzt weiter!
Dem Schuldner zustehende Gelder, die auf ein von einem Dritten (sog. Kontoverleiher) geführtes Konto – es ist dies vornehmlich der Ehepartner, Lebensgefährte oder ein Verwandter – überwiesen werden, sind nicht als Kontokorrentforderung des Schuldners gegenüber dem Kreditinstitut pfändbar.
Klicken Sie hier und lesen Sie mehr!
Hat ein Hartz IV-Bezieher einen Anspruch auf nochmalige Auszahlung einer Nachzahlung in bar, weil ein Gläubiger die Leistung auf dem Pfändungsschutzkonto gepfändet hat? Nein, meinte jetzt das Bayerische Landessozialgericht. Mit Zahlung auf das Konto sei der Leistungsanspruch gegen das Jobcenter erfüllt. Für die Frage des Pfändungsschutzes seien die Vollstreckungsgerichte zuständig.
Die Entscheidungsgründe sehen Sie hier!
Ein P-Konto (Pfändungsschutzkonto) ist ein Girokonto, auf dem nur ein bestimmter Betrag gepfändet werden darf. Dieser Betrag richtet sich nach dem monatlichen Einkommen des Kontoinhabers und wird automatisch vom Kreditinstitut berechnet. Das bedeutet, dass das P-Konto den Kontoinhaber vor einer Kontopfändung schützt, indem es sicherstellt, dass er weiterhin über einen bestimmten Betrag verfügen kann, um seine laufenden Kosten wie Miete, Strom, Lebensmittel etc. zu bezahlen. Der Antrag auf Umwandlung in ein P-Konto ist für den Kontoinhaber kostenlos und kann jederzeit gestellt werden.Das gilt auch für bereits gepfändete Konten.
2023 gab es Änderungen beim P-Konto (Pfändungsschutzkonto) - Hinweise zur P-Kontopfändung mit den neuen ZV-Formularen erfahren Sie hier.
Das Arbeitseinkommen des Antragstellers wurde von der Antragsgegnerin gepfändet. Der Antragsteller begehrt festzustellen, dass der pfändungsfreie Grundbetrag des Arbeitseinkommens wegen der in seinem Haushalt lebenden beiden Stiefkinder erhöht ist.
Lesen Sie hier alle Entscheidungsgründe!
Verträge über den Kauf eines Fahrzeugs und die anschließende Vermietung an den Verkäufer („Cash & Drive“) sind wegen der Umgehung verbraucherschützender Vorschriften der Pfandleihverordnung unwirksam. Das hat das Landgericht München I entschieden. Demnach stehen solche Angebote von Pfandleihhäusern Darlehen mit Sicherungsübereignung gleich, für die eine Banklizenz benötigt wird.
Klicken Sie hier und lesen Sie weiter!
Das Vollstreckungsgericht erlässt auf der Grundlage des Gläubigerantrags den Pfändungsbeschluss, soweit ihm keine Hindernisse entgegenstehen. Was ist nun z.B. bezüglich Inhalt, Kosten, Anfechtbarkeit oder Nichtigkeit zu beachten?
Hier erfahren Sie mehr!
Die Sozialleistungen dienen u.a. der Sicherung des Lebensunterhalts. Ein fundiertes Wissen über die Pfändung von Sozialleistungen ist daher unerlässlich, wenn Ihr Mandant die Wegnahme seiner Lebensgrundlage befürchtet. Unsere Fachbeiträge liefern Ihnen genau das Fachwissen, das Sie als Anwalt benötigen!
Klicken Sie hier für alle wichtigen Information zum Thema Sozialleistungen und deren Pfändung!
Forderungen gegenüber dem Finanzamt: Welche Besonderheiten gibt es bei dieser Vollstreckungsart? Und was muss beim Ausfüllen in den aktuellen ZV-Formularen (Modul G) beachtet werden?
Klicken Sie hier und erfahren Sie alles Wichtige zu den Pfändungen von Forderungen an das Finanzamt.
Das Modul E entspricht dem Anspruch A bei den Altformularen. Die für die Pfändung von Arbeitseinkommen geltenden §§ 850 ff. ZPO sowie die weitergehenden Zugriffsmöglichkeiten bei der Pfändung wegen gesetzlicher Unterhaltsansprüche nach § 850d ZPO sind zu beachten.
Was sich bei der Lohnpfändung durch die neuen Formulare geändert hat, erfahren Sie hier.
Ein Schuldner, der mehrere – laufende, also nicht gem. § 850i ZPO einmalige oder Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit – Arbeitseinkommen, Sozial- oder Naturalleistungen von verschiedenen Drittschuldnern bezieht, wird ungerechtfertigt geschützt, wenn man die unterschiedlichen Einkommen gesondert den Pfändungsfreigrenzen gem. § 850c ZPO unterwirft.
Das Modul N in den neuen Formularen: So funktioniert die Zusammenrechnung von Arbeitseinkommen und Sozialleistungen.
Das Modul J entspricht dem „Anspruch E (an Versicherungsgesellschaften)“ der alten Formulare. Anders als bei den noch verwendbaren Altformularen, fehlt im Modul J folgender Hinweis: „Ausgenommen von der Pfändung sind Ansprüche aus Lebensversicherungen, die nur auf den Todesfall des Versicherungsnehmers abgeschlossen sind, wenn die Versicherungssumme den in § 850b Abs.1 Nummer 4 ZPO in der jeweiligen Fassung genannten Betrag nicht übersteigt.“
Dennoch sind auch nach dem neuen Formular bei der Pfändung von Forderungen aus Versicherungen folgende Dinge zu beachten: Hier klicken und weiterlesen.
Der Grundfreibetrag, der auf dem P-Konto vor der Pfändung geschützt ist, kann unter bestimmten Bedingungen erhöht werden.
Hier finden Sie als Anwalt informative Fachbeiträge zum Erhöhungsbeitrag!